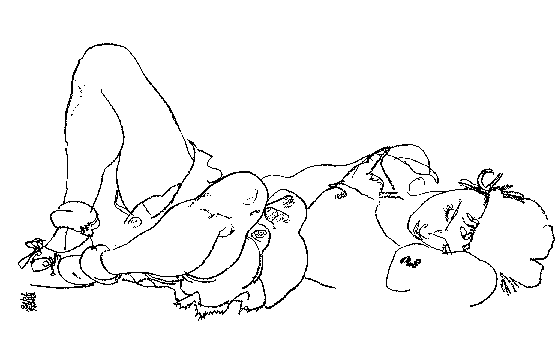http://strindberg.odysseetheater.com
Fräulein Julie
Naturalistisches Trauerspiel
August Strindberg
|
Personen
|
|
| Fräulein Julie, Tochter des Grafen, 25 Jahre | Margherita Ehart |
| Jean, Kammerdiener, 30 Jahre | Wolfgang Peter |
| Christine, Köchin, 35 Jahre | Karin Gerstl |
|
Ort der Handlung: Küche im Schloß des Grafen Zeit: Mittsommernacht
|
|
- Inhalt
- Einladungsfolder
(PDF-Dokument)

- Programmfolder
(PDF-Dokument)

- Chronik
- August Strindberg - Leben und Werk
- August Strindberg, Vorwort zur Erstausgabe Vorwort zur Erstausgabe
- Aus dem BLAUBUCH von August Strindberg:
- Jean-Paul Sartre über Aufrichtigkeit und Selbsttäuschung bei der ersten Begegnung von Mann und Frau
- Franz von Baader, "Ich nenne das Weib darum die Bewahrerin der Liebe ..."
- Abaelard
- Der Briefwechsel mit Heloïsa
Zeugnisse einer verhängnisvollen Liebe
INHALT:
 Ausgelassen feiert das
Gesinde auf einem gräflichen Herrschaftssitz die Mittsommernacht. Fräulein Julie,
die stolze, mannstolle und zugleich männerverachtende, seelisch tief
zerrüttete Tochter des Grafen, fordert den Diener Jean, der mit der
Köchin Christine so gut wie verlobt ist, zum Tanz. Jean,
selbstgefällig, ehrgeizig und
nüchtern berechnend zugleich, hat hochfliegende Pläne und will sich
später einmal als Hotelier in der Schweiz etablieren. Aufreizend frech
und spielerisch verführend kokettiert Julie mit ihm. Zuerst noch
widerstrebend, dann aber immer bereitwilliger erwidert Jean ihre
Annäherungsversuche und nimmt sie schließlich, einem schnellen
Abenteuer nicht abgeneigt, mit auf sein Zimmer.
Ausgelassen feiert das
Gesinde auf einem gräflichen Herrschaftssitz die Mittsommernacht. Fräulein Julie,
die stolze, mannstolle und zugleich männerverachtende, seelisch tief
zerrüttete Tochter des Grafen, fordert den Diener Jean, der mit der
Köchin Christine so gut wie verlobt ist, zum Tanz. Jean,
selbstgefällig, ehrgeizig und
nüchtern berechnend zugleich, hat hochfliegende Pläne und will sich
später einmal als Hotelier in der Schweiz etablieren. Aufreizend frech
und spielerisch verführend kokettiert Julie mit ihm. Zuerst noch
widerstrebend, dann aber immer bereitwilliger erwidert Jean ihre
Annäherungsversuche und nimmt sie schließlich, einem schnellen
Abenteuer nicht abgeneigt, mit auf sein Zimmer.
Der kurzen Lust folgt rasche Ernüchterung. Klar ist, dass eine Liaison zwischen Herrin und Diener im gräflichen Haus unmöglich ist. Fluchtpläne werden geschmiedet und wieder verworfen. Die gereizte Stimmung eskaliert zum Streit. Auf Julies "Knecht ist Knecht" schleudert ihr Jean ein verächtliches "Und Hure ist Hure!" entgegen. Julie wird wird ihm allmählich lästig - und außerdem ist da noch Christine, die ihre älteren Rechte durchaus zu wahren versteht. Tief verzweifelt ergreift Julie schließlich das Rasiermesser, das ihr Jean kalt in die Hand drückt, und verlässt das Haus, um sich umzubringen.
zurück zum Anfang
August Strindberg
Vorwort zur Erstausgabe
 Das Theater ist mir, wie die Kunst überhaupt, lange
als eine Biblia pauperum vorgekommen, als eine Bilderbibel für
alle die, welche nichts Geschriebenes oder Gedrucktes lesen können, und
der Bühnendichter als ein Laienprediger, der die Gedanken der Zeit in
populärer Form so allgemeinverständlich verbreitet, daß der
Mittelstand, der hauptsächlich das Theater füllt, ohne viel
Kopfzerbrechen begreifen kann, worum es geht. Das Theater ist daher
immer eine Schule der Jugend, der Halbgebildeten und der Frauen gewesen,
die noch die niedrigere Fähigkeit besitzen, sich selbst zu betrügen
und sich betrügen zu lassen, das heißt, Illusionen anzunehmen und sich
der Suggestion des Autors zu beugen. In unserer Zeit, da sich das
rudimentäre, unvollständige Denken, das sich durch die Phantasie
vollzieht, anscheinend zu Reflexion, Untersuchung und Prüfung
entwickelt, habe ich deshalb den Eindruck gewonnen, als werde das
Theater, ebenso wie die Religion, im Augenblick als eine aussterbende
Form beiseite gelegt, für deren Genuß uns die erforderlichen
Voraussetzungen fehlen. Für diese Annahme spricht die umfassende
Theaterkrise, die jetzt in ganz Europa herrscht, und nicht zuletzt der
Umstand, daß in den Kulturländern, die die größten Denker unserer
Zeit hervorgebracht haben - nämlich England und Deutschland -, die
Dramatik tot ist ebenso wie der größte Teil der übrigen schönen
Künste. In anderen Ländern hat man dagegen geglaubt, ein neues Drama
schaffen zu können, indem man die alten Formen mit dem Geist der
neueren Zeit füllte; zum einen haben aber die neuen Gedanken nicht die
Zeit gehabt, sich zu verbreiten, so daß das Publikum nicht verstanden
hat, worum es geht; zum anderen haben Parteienkämpfe die Gemüter so
erregt, daß ein reines, interessenfreies Genießen
unmöglich war, da man sich in seinem Innersten abgestoßen fühlte und
- wie dies in einem Theater geschehen kann - eine klatschende oder
pfeifende Menge ihre Übermacht öffentlich ausübte; oder man hat für
den neuen Inhalt doch nicht die richtige Form gewählt, so daß der neue
Wein die alten Flaschen sprengte.
Das Theater ist mir, wie die Kunst überhaupt, lange
als eine Biblia pauperum vorgekommen, als eine Bilderbibel für
alle die, welche nichts Geschriebenes oder Gedrucktes lesen können, und
der Bühnendichter als ein Laienprediger, der die Gedanken der Zeit in
populärer Form so allgemeinverständlich verbreitet, daß der
Mittelstand, der hauptsächlich das Theater füllt, ohne viel
Kopfzerbrechen begreifen kann, worum es geht. Das Theater ist daher
immer eine Schule der Jugend, der Halbgebildeten und der Frauen gewesen,
die noch die niedrigere Fähigkeit besitzen, sich selbst zu betrügen
und sich betrügen zu lassen, das heißt, Illusionen anzunehmen und sich
der Suggestion des Autors zu beugen. In unserer Zeit, da sich das
rudimentäre, unvollständige Denken, das sich durch die Phantasie
vollzieht, anscheinend zu Reflexion, Untersuchung und Prüfung
entwickelt, habe ich deshalb den Eindruck gewonnen, als werde das
Theater, ebenso wie die Religion, im Augenblick als eine aussterbende
Form beiseite gelegt, für deren Genuß uns die erforderlichen
Voraussetzungen fehlen. Für diese Annahme spricht die umfassende
Theaterkrise, die jetzt in ganz Europa herrscht, und nicht zuletzt der
Umstand, daß in den Kulturländern, die die größten Denker unserer
Zeit hervorgebracht haben - nämlich England und Deutschland -, die
Dramatik tot ist ebenso wie der größte Teil der übrigen schönen
Künste. In anderen Ländern hat man dagegen geglaubt, ein neues Drama
schaffen zu können, indem man die alten Formen mit dem Geist der
neueren Zeit füllte; zum einen haben aber die neuen Gedanken nicht die
Zeit gehabt, sich zu verbreiten, so daß das Publikum nicht verstanden
hat, worum es geht; zum anderen haben Parteienkämpfe die Gemüter so
erregt, daß ein reines, interessenfreies Genießen
unmöglich war, da man sich in seinem Innersten abgestoßen fühlte und
- wie dies in einem Theater geschehen kann - eine klatschende oder
pfeifende Menge ihre Übermacht öffentlich ausübte; oder man hat für
den neuen Inhalt doch nicht die richtige Form gewählt, so daß der neue
Wein die alten Flaschen sprengte.
 Im vorliegenden Drama habe ich nicht versucht, etwas
Neues zu schaffen - denn das kann man nicht —, sondern nur die Form
entsprechend den Forderungen umgestaltet, die die neuen Menschen unserer
Zeit an diese Kunst meiner Meinung nach stellen werden. Zu diesem Zweck
habe ich ein Motiv gewählt oder mich von ihm packen lassen, das
sozusagen außerhalb der gegenwärtigen Parteikämpfe liegt, da das
Problem des sozialen Aufstiegs und Falls, des Höheren und Niedrigeren,
des Besseren oder des Minderwertigeren, von Mann oder Frau von
bleibendem Interesse ist, war und sein wird. Dieses Motiv ist aus dem
Leben gegriffen; als ich die Geschichte vor einigen Jahren hörte,
machte sie einen tiefen Eindruck auf mich, und sie schien mir für ein
Trauerspiel geeignet; denn ist es schon traurig, einen vom Schicksal
begünstigten Menschen untergehen zu sehen, so ist es noch trauriger,
ein ganzes Geschlecht aussterben zu sehen. Es wird aber vielleicht eine
Zeit kommen, in der wir so fortschrittlich, so aufgeklärt sein werden,
daß wir das jetzt rohe, zynische und herzlose Schauspiel des Lebens mit
Gleichgültigkeit betrachten, weil wir diese niederen, unzuverlässigen
Gedankenmaschinen, die man Gefühle nennt, abgeschaltet haben, die ja
überflüssig und schädlich werden, sobald sich unsere Urteilsorgane
entwickelt haben. Daß die Heldin Mitleid erregt, beruht einzig auf
unserer Schwäche, uns nicht dem Gefühl der Furcht zu widersetzen, das
gleiche Schicksal könnte auch uns treffen. Der sehr empfindsame
Zuschauer wird sich vielleicht mit diesem Mitleid nicht begnügen, und
der von Zuversicht erfüllte Mann der Zukunft wird vielleicht einige
positive Vorschläge zur Abhilfe des Bösen fordern, ein Programm, mit
anderen Worten.
Im vorliegenden Drama habe ich nicht versucht, etwas
Neues zu schaffen - denn das kann man nicht —, sondern nur die Form
entsprechend den Forderungen umgestaltet, die die neuen Menschen unserer
Zeit an diese Kunst meiner Meinung nach stellen werden. Zu diesem Zweck
habe ich ein Motiv gewählt oder mich von ihm packen lassen, das
sozusagen außerhalb der gegenwärtigen Parteikämpfe liegt, da das
Problem des sozialen Aufstiegs und Falls, des Höheren und Niedrigeren,
des Besseren oder des Minderwertigeren, von Mann oder Frau von
bleibendem Interesse ist, war und sein wird. Dieses Motiv ist aus dem
Leben gegriffen; als ich die Geschichte vor einigen Jahren hörte,
machte sie einen tiefen Eindruck auf mich, und sie schien mir für ein
Trauerspiel geeignet; denn ist es schon traurig, einen vom Schicksal
begünstigten Menschen untergehen zu sehen, so ist es noch trauriger,
ein ganzes Geschlecht aussterben zu sehen. Es wird aber vielleicht eine
Zeit kommen, in der wir so fortschrittlich, so aufgeklärt sein werden,
daß wir das jetzt rohe, zynische und herzlose Schauspiel des Lebens mit
Gleichgültigkeit betrachten, weil wir diese niederen, unzuverlässigen
Gedankenmaschinen, die man Gefühle nennt, abgeschaltet haben, die ja
überflüssig und schädlich werden, sobald sich unsere Urteilsorgane
entwickelt haben. Daß die Heldin Mitleid erregt, beruht einzig auf
unserer Schwäche, uns nicht dem Gefühl der Furcht zu widersetzen, das
gleiche Schicksal könnte auch uns treffen. Der sehr empfindsame
Zuschauer wird sich vielleicht mit diesem Mitleid nicht begnügen, und
der von Zuversicht erfüllte Mann der Zukunft wird vielleicht einige
positive Vorschläge zur Abhilfe des Bösen fordern, ein Programm, mit
anderen Worten.
 Aber erstens gibt es nichts absolut Böses, denn wenn
ein Geschlecht untergeht, so bedeutet dies ja ein Glück für ein
anderes Geschlecht, das nun emporkommen kann. Und dann gehört der
Wechsel von Aufstieg und Fall zu den größten Annehmlichkeiten des
Lebens, da das Glück nur im Vergleich liegt. Zudem möchte ich den Mann
des Programms, der dem bedauerlichen Umstand abhelfen will, daß der
Raubvogel die Taube frißt und die Laus den Raubvogel, fragen: warum
soll da geholfen werden? Das Leben ist nicht so mathematisch-idiotisch,
daß nur die Großen die Kleinen fressen, sondern es kommt ebenso
häufig vor, daß die Biene den Löwen tötet oder ihn zumindest
verrückt macht.
Aber erstens gibt es nichts absolut Böses, denn wenn
ein Geschlecht untergeht, so bedeutet dies ja ein Glück für ein
anderes Geschlecht, das nun emporkommen kann. Und dann gehört der
Wechsel von Aufstieg und Fall zu den größten Annehmlichkeiten des
Lebens, da das Glück nur im Vergleich liegt. Zudem möchte ich den Mann
des Programms, der dem bedauerlichen Umstand abhelfen will, daß der
Raubvogel die Taube frißt und die Laus den Raubvogel, fragen: warum
soll da geholfen werden? Das Leben ist nicht so mathematisch-idiotisch,
daß nur die Großen die Kleinen fressen, sondern es kommt ebenso
häufig vor, daß die Biene den Löwen tötet oder ihn zumindest
verrückt macht.
Daß mein Trauerspiel auf viele einen traurigen Eindruck macht, ist die Schuld dieser Vielen. Wenn wir stark werden wie die ersten Männer der Französischen Revolution, wird es ein unbedingt guter und erfreulicher Eindruck sein, wenn man sieht, wie die Parkanlagen von morschen, überständigen Bäumen befreit werden, die anderen mit dem gleichen Lebensrecht zu lange im Wege gestanden sind - ein guter Eindruck, wie wenn man sieht, daß ein unheilbar Kranker sterben darf!
Man warf neulich meinem Trauerspiel Der Vater vor, daß es traurig sei - ganz so, als ob man heitere Trauerspiele forderte! Man ruft voller Anmaßung nach Lebensfreude, und die Theaterdirektoren bestellen Schwanke, als ob die Lebensfreude darin bestünde, albern zu sein und Menschen zu zeichnen, als wären alle mit Veitstanz oder Idiotie behaftet. Ich finde die Lebensfreude in den starken, grausamen Kämpfen des Lebens, und es bereitet Vergnügen, etwas zu erfahren, etwas zu lernen. Und deshalb habe ich einen ungewöhnlichen Fall gewählt, aber einen lehrreichen, mit einem Wort: eine Ausnahme, jedoch eine große Ausnahme, die die Regel bestätigt, was sicher diejenigen verletzen wird, die das Banale lieben. Was dann noch ein schlichtes Gemüt vor den Kopf stoßen wird, ist, daß meine Motivierung der Handlung nicht einfach und der Blickwinkel nicht nur auf einen einzigen beschränkt ist. Ein Ereignis im Leben - und das ist eine ziemlich neue Entdeckung! — wird gewöhnlich von einer ganzen Reihe mehr oder weniger untergründiger Motive hervorgerufen, aber der Zuschauer wählt meist das Motiv, das für seine Einsicht am leichtesten zu begreifen oder für sein Urteilsvermögen am schmeichelhaftesten ist. Es wird ein Selbstmord begangen: „Schlechte Geschäfte!" sagt der Bürger. „Unglückliche Liebe!" sagen die Frauen. „Körperliche Krankheit!" der Kranke, „Zerstörte Hoffnungen!" der Schiffbrüchige. Nun kann es aber vorkommen, daß das Motiv überall oder nirgends zu suchen war und daß der Verstorbene das eigentliche Motiv verborgen hatte, indem er ein anderes vorschützte, das auf sein Andenken das beste Licht warf!
 Fräulein Julies trauriges Geschick habe ich mit einer
ganzen Reihe von Faktoren begründet: mit der Grundanlage der Mutter,
der falschen Erziehung des Mädchens durch den Vater, dem eigenen
Naturell und dem Einfluß des Verlobten auf das schwache, degenerierte
Gehirn, mehr noch mit der Feststimmung in der Mittsommernacht, der
Abwesenheit des Vaters, ihrer Menstruation, der Beschäftigung mit den
Tieren, dem aufreizenden Einfluß des Tanzes, dem Dämmerlicht der
Nacht, der starken, aphrodisischen Wirkung der Blumen, und schließlich
dem Zufall, der die beiden in einem entlegenen Zimmer zusammentreibt,
dazu kommt die Zudringlichkeit des erregten Mannes. Ich bin also nicht
einseitig physiologisch verfahren, nicht monoman psychologisch, ich habe
nicht nur dem Erbteil von Seiten der Mutter die Schuld gegeben, nicht
die Schuld nur bei der Menstruation oder ausschließlich bei der „Unsittlichkeit"
gesucht, nicht nur Moral gepredigt! Letzteres habe ich einer Köchin
überlassen, da kein Pfarrer auftritt. Dieser Vielfalt der Motive will
ich mich rühmen, da sie zeitgemäß ist! Und haben andere dies vor mir
getan, so rühme ich mich, nicht allein zu stehen mit meinen Paradoxien,
wie alle Entdeckungen genannt werden. Was die Charakterzeichnung
betrifft, so habe ich aus folgenden Gründen die Figuren ziemlich „charakterlos"
gemacht:
Fräulein Julies trauriges Geschick habe ich mit einer
ganzen Reihe von Faktoren begründet: mit der Grundanlage der Mutter,
der falschen Erziehung des Mädchens durch den Vater, dem eigenen
Naturell und dem Einfluß des Verlobten auf das schwache, degenerierte
Gehirn, mehr noch mit der Feststimmung in der Mittsommernacht, der
Abwesenheit des Vaters, ihrer Menstruation, der Beschäftigung mit den
Tieren, dem aufreizenden Einfluß des Tanzes, dem Dämmerlicht der
Nacht, der starken, aphrodisischen Wirkung der Blumen, und schließlich
dem Zufall, der die beiden in einem entlegenen Zimmer zusammentreibt,
dazu kommt die Zudringlichkeit des erregten Mannes. Ich bin also nicht
einseitig physiologisch verfahren, nicht monoman psychologisch, ich habe
nicht nur dem Erbteil von Seiten der Mutter die Schuld gegeben, nicht
die Schuld nur bei der Menstruation oder ausschließlich bei der „Unsittlichkeit"
gesucht, nicht nur Moral gepredigt! Letzteres habe ich einer Köchin
überlassen, da kein Pfarrer auftritt. Dieser Vielfalt der Motive will
ich mich rühmen, da sie zeitgemäß ist! Und haben andere dies vor mir
getan, so rühme ich mich, nicht allein zu stehen mit meinen Paradoxien,
wie alle Entdeckungen genannt werden. Was die Charakterzeichnung
betrifft, so habe ich aus folgenden Gründen die Figuren ziemlich „charakterlos"
gemacht:
 Der Begriff „Charakter" hat im Lauf der Zeit
verschiedenartige Bedeutungen angenommen. Ursprünglich meinte er wohl
den vorherrschenden Grundzug im Ganzen der Seele und wurde mit dem
Temperament verwechselt. Später war er die Bezeichnung des
Mittelstandes für einen automatisch Handelnden, so daß ein Individuum,
das ein für allemal bei seinem Naturell blieb oder sich einer
bestimmten Rolle im Leben angepaßt, mit einem Wort: zu wachsen
aufgehört hatte, „Charakter" genannt wurde, während ein sich
entwickelnder Mensch, der geschickte Steuermann auf dem Strom des
Lebens, der nicht mit festen Schoten segelte, sondern den Sturmböen
nachgab, um dann wieder anzuluven, charakterlos hieß. Natürlich im
abschätzigen Sinn, weil er so schwer zu fassen, zu registrieren und zu
überwachen war. Dieser bürgerliche Begriff von der Unwandelbarkeit der
Seele wurde auf die Bühne übertragen, wo die bürgerliche
Weltanschauung immer geherrscht hat. Als ein Charakter erschien dort ein
Herr, der fix und fertig war, ständig betrunken oder scherzend oder
traurig auftrat, und zu dessen Charakterisierung es genügte, daß man
ihm ein körperliches Gebrechen zuwies, einen Klumpfuß, ein Holzbein,
eine rote Nase, oder daß man den Betreffenden einen Ausdruck wie „Das
ist galant" und dergleichen wiederholen ließ. Dieses einfache Bild
vom Menschen findet sich noch bei dem großen Moliere. Harpagon ist nur
geizig, obwohl Harpagon geizig und dazu ein ausgezeichneter Finanzmann,
ein prächtiger Vater und ein guter Kommunalpolitiker hätte sein
können, und - was schlimmer ist - sein „Fehler" sich äußerst
vorteilhaft gerade für seinen Schwiegersohn und seine Tochter auswirkt,
die die Erben sind und ihn deshalb nicht tadeln dürften, auch wenn sie
noch etwas warten müssen, bis sie ins Ehebett kommen. Ich glaube
deshalb nicht an einfache Theatercharaktere. Und die summarischen
Urteile der Autoren über die Menschen „Der ist dumm, jener ist
brutal, dieser ist eifersüchtig, jener ist geizig" und so
weiter sollten von Naturalisten abgelehnt werden, die wissen, wie reich
die Seele als Ganzes ist, und die spüren, daß das „Laster" eine
Kehrseite hat, die sehr wohl der Tugend gleicht.
Der Begriff „Charakter" hat im Lauf der Zeit
verschiedenartige Bedeutungen angenommen. Ursprünglich meinte er wohl
den vorherrschenden Grundzug im Ganzen der Seele und wurde mit dem
Temperament verwechselt. Später war er die Bezeichnung des
Mittelstandes für einen automatisch Handelnden, so daß ein Individuum,
das ein für allemal bei seinem Naturell blieb oder sich einer
bestimmten Rolle im Leben angepaßt, mit einem Wort: zu wachsen
aufgehört hatte, „Charakter" genannt wurde, während ein sich
entwickelnder Mensch, der geschickte Steuermann auf dem Strom des
Lebens, der nicht mit festen Schoten segelte, sondern den Sturmböen
nachgab, um dann wieder anzuluven, charakterlos hieß. Natürlich im
abschätzigen Sinn, weil er so schwer zu fassen, zu registrieren und zu
überwachen war. Dieser bürgerliche Begriff von der Unwandelbarkeit der
Seele wurde auf die Bühne übertragen, wo die bürgerliche
Weltanschauung immer geherrscht hat. Als ein Charakter erschien dort ein
Herr, der fix und fertig war, ständig betrunken oder scherzend oder
traurig auftrat, und zu dessen Charakterisierung es genügte, daß man
ihm ein körperliches Gebrechen zuwies, einen Klumpfuß, ein Holzbein,
eine rote Nase, oder daß man den Betreffenden einen Ausdruck wie „Das
ist galant" und dergleichen wiederholen ließ. Dieses einfache Bild
vom Menschen findet sich noch bei dem großen Moliere. Harpagon ist nur
geizig, obwohl Harpagon geizig und dazu ein ausgezeichneter Finanzmann,
ein prächtiger Vater und ein guter Kommunalpolitiker hätte sein
können, und - was schlimmer ist - sein „Fehler" sich äußerst
vorteilhaft gerade für seinen Schwiegersohn und seine Tochter auswirkt,
die die Erben sind und ihn deshalb nicht tadeln dürften, auch wenn sie
noch etwas warten müssen, bis sie ins Ehebett kommen. Ich glaube
deshalb nicht an einfache Theatercharaktere. Und die summarischen
Urteile der Autoren über die Menschen „Der ist dumm, jener ist
brutal, dieser ist eifersüchtig, jener ist geizig" und so
weiter sollten von Naturalisten abgelehnt werden, die wissen, wie reich
die Seele als Ganzes ist, und die spüren, daß das „Laster" eine
Kehrseite hat, die sehr wohl der Tugend gleicht.
 Ich habe meine Figuren schwankender und zerrissener,
als eine Mischung aus Altem und Neuem, geschaffen, da sie als moderne
Charaktere in einer Übergangszeit leben, die rascher und hysterischer
ist als die vorausgegangene, und ich halte es nicht für
unwahrscheinlich, daß moderne Ideen durch Zeitungen und Gespräche bis
zu jener Schicht gedrungen sind, in der ein Kammerdiener lebt. Meine
Seelen (Charaktere) sind Konglomerate vergangener und gegenwärtiger
Kulturstufen, sie sind Stücke aus Büchern und Zeitungen, Teile von
Menschen, Fetzen von Festtagskleidern, die zu Lumpen wurden, ganz wie
die Seele zusammengeflickt ist. Außerdem habe ich etwas
Entwicklungsgeschichte geboten, ich lasse nämlich den Schwächeren
Worte des Stärkeren stehlen und wiederholen, lasse die Seelen „Ideen",
sogenannte Suggestionen, voneinander übernehmen.
Ich habe meine Figuren schwankender und zerrissener,
als eine Mischung aus Altem und Neuem, geschaffen, da sie als moderne
Charaktere in einer Übergangszeit leben, die rascher und hysterischer
ist als die vorausgegangene, und ich halte es nicht für
unwahrscheinlich, daß moderne Ideen durch Zeitungen und Gespräche bis
zu jener Schicht gedrungen sind, in der ein Kammerdiener lebt. Meine
Seelen (Charaktere) sind Konglomerate vergangener und gegenwärtiger
Kulturstufen, sie sind Stücke aus Büchern und Zeitungen, Teile von
Menschen, Fetzen von Festtagskleidern, die zu Lumpen wurden, ganz wie
die Seele zusammengeflickt ist. Außerdem habe ich etwas
Entwicklungsgeschichte geboten, ich lasse nämlich den Schwächeren
Worte des Stärkeren stehlen und wiederholen, lasse die Seelen „Ideen",
sogenannte Suggestionen, voneinander übernehmen.
Fräulein Julie ist ein moderner Charakter: zwar hat
es das Halbweib, die Männerhasserin zu allen Zeiten gegeben, doch wurde
dieses Phänomen jetzt erst wahrgenommen; es trat in unseren Tagen in
Erscheinung und machte großen Wirbel. Das Halbweib ist der Typus, der
sich vordrängt, sich jetzt für Macht, Orden, Auszeichnungen und
Diplome wie früher für Geld verkauft und auf Entartung hindeutet. Es
handelt sich um keine gute Art, denn sie hat keinen Bestand, pflanzt
sich aber leider mit ihrem Elend in der nächsten Generation fort.  Und
entartete Männer scheinen unbewußt ihre Wahl unter den Halbweibern zu
treffen, so daß diese sich vermehren und Wesen unbestimmten Geschlechts
hervorbringen, die sich mit dem Leben abquälen, aber glücklicherweise
zugrunde gehen, entweder in Disharmonie mit der Wirklichkeit, durch ein
unwiderstehliches Hervorbrechen des unterdrückten Triebs oder wegen der
zerstörten Hoffnungen, es mit dem Mann aufnehmen zu können.
Der Typus ist tragisch, da er das Schauspiel eines verzweifelten Kampfes
wider die Natur bietet, tragisch als ein romantisches Erbe, das jetzt
vom Naturalismus verschleudert wird, der nur das Glück will. Und für
das Glück braucht man starke und gute Naturen. Aber Fräulein Julie ist
auch ein Überbleibsel des alten Kriegeradels, der jetzt dem neuen
Nerven- oder Großhirnadel Platz macht; ein Opfer der Disharmonie, die
das „Verbrechen" einer Mutter innerhalb einer Familie verursacht
hat; ein Opfer von Irrtümern der Zeit, ein Opfer der Umstände und der
eigenen mangelhaften Konstitution, was alles zusammengenommen wieder dem
altbekannten Schicksal oder dem Gesetz des Universums gleichkommt. Denn
Schuld und Gott hat der Naturalist zwar gleichermaßen aus der Welt
geschafft, aber die Folgen des Handelns: Strafe, Gefängnis oder die
Furcht davor, kann er nicht beseitigen. Sie bleiben, ob er nun die
Entlastung erteilt oder nicht, aus dem einfachen Grund bestehen, weil
die übervorteilten Mitmenschen nicht so gutmütig sind, wie es die
nicht übervorteilten Außenstehenden billigerweise sein können. Auch
wenn der Vater aus zwingenden Gründen die Rache aufgeben würde, nähme
die Tochter, wie sie es hier tut, aus jenem angeborenen oder erworbenen
Ehrgefühl an sich selbst Rache, das die höheren Klassen aus der
Barbarei, der arischen Urheimat, vom Rittertum des Mittelalters erben;
ein recht hübscher Zug, aber heutzutage für die Erhaltung der Art
nachteilig. Es ist das Harakiri des Edelmannes, das innere
Gewissensgesetz des Japaners, das ihm befiehlt, sich den Bauch
aufzuschlitzen, wenn ihn ein anderer beleidigt hat, was - modifiziert -
im Adelsprivileg des Duells fortlebt. Deshalb bleibt der Kammerdiener
Jean am Leben, während Fräulein Julie ohne Ehre nicht leben kann. Das
hat der Knecht dem Jarl voraus, daß ihm dieses lebensgefährliche
Vorurteil in bezug auf die Ehre fehlt. In uns Ariern aber steckt etwas
vom Edelmann oder Don Quijote, das uns mit dem Selbstmörder
sympathisieren läßt, der eine ehrlose Handlung begangen und damit die
Ehre verloren hat. Auch haben wir genug vom
Edelmann in uns, daß es uns eine Qual ist, eine gefallene Größe wie
eine Leiche herumliegen zu sehen, selbst wenn sich der Gefallene wieder
erheben und alles durch ehrenhafte Handlungen gutmachen würde. Der
Diener Jean bildet einen neuen Typus, an dem die Differenzierung
sichtbar wird. Er ist als Kind eines Taglöhners geboren und hat sich
jetzt zu einem künftigen Herren herangebildet. Er hat leicht gelernt,
er besitzt fein entwickelte Sinne (Riechen, Schmecken, Sehen) und ein
Gefühl für Schönheit. Er ist schon emporgekommen und hat genügend
Stärke, die Dienste anderer Menschen zu benützen, ohne sich verletzt
zu fühlen. Er ist seiner Umgebung bereits fremd geworden, die er als
eine überwundene Stufe verachtet, und die er fürchtet und flieht, da
man dort seine Geheimnisse kennt, seine Absichten durchschaut, seinen
Aufstieg mit Neid betrachtet und seinem Fall mit Vergnügen
entgegensieht. Daher sein zwiespältiger, unentschiedener Charakter, der
zwischen Sympathie für das Hochgestellte und Haß gegen diejenigen
schwankt, die jetzt dort oben sitzen. Er ist Aristokrat, sagt er selbst,
hat sich die Geheimnisse der guten Gesellschaft angeeignet, besitzt
Politur, ist aber darunter roh; er trägt bereits den Gehrock mit
Geschmack, ohne irgendeine Garantie zu bieten, daß er am Körper sauber
ist.
Und
entartete Männer scheinen unbewußt ihre Wahl unter den Halbweibern zu
treffen, so daß diese sich vermehren und Wesen unbestimmten Geschlechts
hervorbringen, die sich mit dem Leben abquälen, aber glücklicherweise
zugrunde gehen, entweder in Disharmonie mit der Wirklichkeit, durch ein
unwiderstehliches Hervorbrechen des unterdrückten Triebs oder wegen der
zerstörten Hoffnungen, es mit dem Mann aufnehmen zu können.
Der Typus ist tragisch, da er das Schauspiel eines verzweifelten Kampfes
wider die Natur bietet, tragisch als ein romantisches Erbe, das jetzt
vom Naturalismus verschleudert wird, der nur das Glück will. Und für
das Glück braucht man starke und gute Naturen. Aber Fräulein Julie ist
auch ein Überbleibsel des alten Kriegeradels, der jetzt dem neuen
Nerven- oder Großhirnadel Platz macht; ein Opfer der Disharmonie, die
das „Verbrechen" einer Mutter innerhalb einer Familie verursacht
hat; ein Opfer von Irrtümern der Zeit, ein Opfer der Umstände und der
eigenen mangelhaften Konstitution, was alles zusammengenommen wieder dem
altbekannten Schicksal oder dem Gesetz des Universums gleichkommt. Denn
Schuld und Gott hat der Naturalist zwar gleichermaßen aus der Welt
geschafft, aber die Folgen des Handelns: Strafe, Gefängnis oder die
Furcht davor, kann er nicht beseitigen. Sie bleiben, ob er nun die
Entlastung erteilt oder nicht, aus dem einfachen Grund bestehen, weil
die übervorteilten Mitmenschen nicht so gutmütig sind, wie es die
nicht übervorteilten Außenstehenden billigerweise sein können. Auch
wenn der Vater aus zwingenden Gründen die Rache aufgeben würde, nähme
die Tochter, wie sie es hier tut, aus jenem angeborenen oder erworbenen
Ehrgefühl an sich selbst Rache, das die höheren Klassen aus der
Barbarei, der arischen Urheimat, vom Rittertum des Mittelalters erben;
ein recht hübscher Zug, aber heutzutage für die Erhaltung der Art
nachteilig. Es ist das Harakiri des Edelmannes, das innere
Gewissensgesetz des Japaners, das ihm befiehlt, sich den Bauch
aufzuschlitzen, wenn ihn ein anderer beleidigt hat, was - modifiziert -
im Adelsprivileg des Duells fortlebt. Deshalb bleibt der Kammerdiener
Jean am Leben, während Fräulein Julie ohne Ehre nicht leben kann. Das
hat der Knecht dem Jarl voraus, daß ihm dieses lebensgefährliche
Vorurteil in bezug auf die Ehre fehlt. In uns Ariern aber steckt etwas
vom Edelmann oder Don Quijote, das uns mit dem Selbstmörder
sympathisieren läßt, der eine ehrlose Handlung begangen und damit die
Ehre verloren hat. Auch haben wir genug vom
Edelmann in uns, daß es uns eine Qual ist, eine gefallene Größe wie
eine Leiche herumliegen zu sehen, selbst wenn sich der Gefallene wieder
erheben und alles durch ehrenhafte Handlungen gutmachen würde. Der
Diener Jean bildet einen neuen Typus, an dem die Differenzierung
sichtbar wird. Er ist als Kind eines Taglöhners geboren und hat sich
jetzt zu einem künftigen Herren herangebildet. Er hat leicht gelernt,
er besitzt fein entwickelte Sinne (Riechen, Schmecken, Sehen) und ein
Gefühl für Schönheit. Er ist schon emporgekommen und hat genügend
Stärke, die Dienste anderer Menschen zu benützen, ohne sich verletzt
zu fühlen. Er ist seiner Umgebung bereits fremd geworden, die er als
eine überwundene Stufe verachtet, und die er fürchtet und flieht, da
man dort seine Geheimnisse kennt, seine Absichten durchschaut, seinen
Aufstieg mit Neid betrachtet und seinem Fall mit Vergnügen
entgegensieht. Daher sein zwiespältiger, unentschiedener Charakter, der
zwischen Sympathie für das Hochgestellte und Haß gegen diejenigen
schwankt, die jetzt dort oben sitzen. Er ist Aristokrat, sagt er selbst,
hat sich die Geheimnisse der guten Gesellschaft angeeignet, besitzt
Politur, ist aber darunter roh; er trägt bereits den Gehrock mit
Geschmack, ohne irgendeine Garantie zu bieten, daß er am Körper sauber
ist.
 Er hat Respekt vor dem Fräulein, fürchtet aber
Christine, da sie seine gefährlichen Geheimnisse kennt; er ist
gefühllos genug, seine Zukunftspläne durch die Ereignisse der Nacht
nicht stören zu lassen. Mit der Roheit des Sklaven und der fehlenden
Weichherzigkeit des Herrschers kann er Blut sehen, ohne in Ohnmacht zu
fallen, und er kann bei einem Mißgeschick zupacken und es abwehren.
Daher geht er unverwundet aus dem Kampf hervor und endet wahrscheinlich
als Hotelbesitzer, und wenn er kein rumänischer Graf wird, so
wird sein Sohn wahrscheinlich Student und womöglich Kronvogt.
Er hat Respekt vor dem Fräulein, fürchtet aber
Christine, da sie seine gefährlichen Geheimnisse kennt; er ist
gefühllos genug, seine Zukunftspläne durch die Ereignisse der Nacht
nicht stören zu lassen. Mit der Roheit des Sklaven und der fehlenden
Weichherzigkeit des Herrschers kann er Blut sehen, ohne in Ohnmacht zu
fallen, und er kann bei einem Mißgeschick zupacken und es abwehren.
Daher geht er unverwundet aus dem Kampf hervor und endet wahrscheinlich
als Hotelbesitzer, und wenn er kein rumänischer Graf wird, so
wird sein Sohn wahrscheinlich Student und womöglich Kronvogt.
Er gibt übrigens sehr wichtige Auskünfte über die Lebensauffassung aus der niederen Perspektive der unteren Klassen, wenn er nämlich die Wahrheit sagt - was nicht oft geschieht —, denn er spricht aus, was ihm nützt, nicht, was wahr ist. Als Fräulein Julie die Vermutung äußert, daß alle Angehörigen der unteren Klassen den Druck von oben als Last empfänden, pflichtet Jean ihr natürlich bei, da er ihre Sympathie gewinnen will, er korrigiert aber sofort seine Äußerung, als er einen Vorteil darin erkennt, sich von der Menge zu distanzieren.
Abgesehen von seinem sozialen Aufstieg steht Jean auch deshalb über Fräulein Julie, weil er ein Mann ist. In geschlechtlicher Hinsicht ist er der Aristokrat durch seine männliche Stärke, seine feiner entwickelten Sinne und seine Entschlußkraft. Seine Unterlegenheit besteht hauptsächlich im sozialen Milieu, in dem er zufällig lebt, und das er vermutlich mit der Dienerlivree ablegen kann. Sein Sklavensinn äußert sich in seiner Ehrfurcht vor dem Grafen (die Stiefel) und in seinem religiösen Aberglauben; aber er verehrt im Grafen den Inhaber der höheren Stellung, nach der er selbst strebt. Diese Ehrfurcht steckt sogar noch in ihm, nachdem er die Tochter des Hauses erobert und erkannt hat, wie nichtig die schöne Schale war. Ich glaube nicht, daß ein Liebesverhältnis im „höheren" Sinn zwischen zwei so ungleichen Seelen entstehen kann, und deshalb lasse ich Fräulein Julie ihre Liebe als Schutz oder Entschuldigung erdichten, und ich lasse Jean vermuten, daß sich für ihn unter anderen sozialen Verhältnissen eine Liebe entwickeln würde. Ich glaube, mit der Liebe ist es wie mit der Hyazinthe, die im Dunkeln Wurzeln schlagen muß, bevor sie eine kräftige Blüte entwickeln kann. Hier schießt sie empor und bildet zugleich Blüte und Samen, und darum stirbt die Pflanze so schnell.
Christine schließlich ist eine Sklavin, voller Unselbständigkeit und Stumpfsinn, erworben am Herdfeuer; sie ist vollgepfropft mit Moral und Religion, die für sie Deckmantel und Sündenbock abgeben. Sie geht in die Kirche, um die Diebstähle im Haus leicht und schnell bei Jesus abzuladen und eine neue Ladung Unschuld einzupacken. Im übrigen ist sie eine Nebenfigur und darum absichtlich nur skizziert, wie ich es bei dem Pastor und dem Arzt in Der Vater gemacht habe, da ich ja Alltagsmenschen zeichnen wollte, wie es Landpastoren und Provinzärzte meist sind. Daß diese Nebenfiguren einigen abstrakt erschienen, ist darin begründet, daß Alltagsmenschen in gewisser Weise abstrakt in ihrer Berufsausübung sind, das heißt unselbständig und durch ihre berufliche Tätigkeit einseitig; und solange der Zuschauer kein Bedürfnis empfindet, diese Figuren von mehreren Seiten zu sehen, ist meine abstrakte Schilderung ziemlich richtig.
Was schließlich den Dialog betrifft, so habe ich etwas mit der Tradition gebrochen, indem ich meine Personen nicht zu Katecheten gemacht habe, die dumme Frage stellen, um eine geistreiche Antwort herauszuholen. Ich habe das Symmetrische und Mathematische des französischen, konstruierten Dialogs vermieden und die Gehirne unregelmäßig arbeiten lassen, wie sie es in Wirklichkeit tun, wo ja in einer Unterhaltung kein Thema erschöpfend behandelt wird, sondern das eine Gehirn auf gut Glück einen Radzahn geboten bekommt, in den es eingreifen kann. Deshalb irrt der Dialog auch hin und her und versieht sich in den ersten Szenen mit einem Material, das dann bearbeitet, aufgenommen, wiederholt, erweitert und präsentiert wird wie das Thema in einer musikalischen Komposition.
 Die Handlung ist ganz passabel, und da sie sich
eigentlich nur um zwei Personen dreht, habe ich mich auf diese
beschränkt, nur eine Nebenfigur, die Köchin, hinzugefügt und den
unglücklichen Geist des Vaters über und hinter dem Ganzen schweben
lassen. Ich habe dies getan, weil ich, wie ich glaube, erkannt habe,
daß der psychologische Verlauf die Menschen unserer Zeit am meisten
interessiert und daß sie sich nicht mit der Beobachtung eines Vorgangs
zufriedengeben, ohne zu erfahren, wie sich alles ergibt! Wir wollen
gerade die Fäden sehen, die Maschinerie, wollen die Schachtel mit dem
doppelten Boden untersuchen, den Zauberring anstecken,
um die Naht zu finden, und in die Karten schauen, um zu entdecken, wie
sie gezinkt sind. Ich habe dabei die monographischen Romane der Brüder
Goncourt vor Augen gehabt, die mich von der ganzen zeitgenössischen
Literatur am meisten angesprochen haben. Was die technische Seite der
Komposition betrifft, so habe ich versuchsweise die Einteilung in Akte
aufgegeben. Ich glaube nämlich herausgefunden zu haben, daß unsere
schwindende Illusionsfähigkeit durch Pausen gestört wird, in denen der
Zuschauer Zeit zum Nachdenken hat und sich dadurch dem suggestiven
Einfluß des Verfasser-Magneti-seurs entzieht. Mein Stück dauert
vermutlich neunzig Minuten, und wenn man eine Vorlesung, eine Predigt
oder einen Vortrag auf einem Kongreß ebenso lange oder noch länger
anhören kann, so war ich der Ansicht, daß man bei einem Theaterstück
von anderthalb Stunden nicht ermüdet. Bereits 1872 erprobte ich in
einem meiner ersten Theaterversuche, in Der Friedlose, diese
konzentrierte Form, wenn auch mit geringem Erfolg. Das Stück war in
fünf Akte eingeteilt und lag fertig vor, als ich seine diffuse
gestörte Wirkung bemerkte. Es wurde verbrannt, und aus der Asche ging
ein einziger, großer, durchgearbeiteter Akt von fünzig Druckseiten
hervor, mit einer Spielzeit von einer ganzen Stunde. Die Form ist
durchaus nicht neu, scheint aber mein Eigentum zu sein und hat
möglicherweise durch einen geänderten Publikumsgeschmack Aussicht,
zeitgemäß zu werden. Meine Absicht ist es, das Publikum künftighin so
zu erziehen, daß es ein abendfüllendes Schauspiel in einem einzigen
Akt absitzen kann. Aber das erfordert zunächst Untersuchungen. Um
jedoch dem Publikum und den Schauspielern Ruhepausen zu gönnen, ohne
daß sich der Zuschauer der Illusion entzieht, habe ich drei
künstlerische Formen aufgegriffen, die alle zur dramatischen Dichtung
gehören, nämlich den Monolog, die Pantomime und das Ballett. Sie waren
ursprünglich mit der antiken Tragödie verbunden, heute entwickeln sich
jedoch aus der Monodie der Monolog und aus dem Chor das Ballett.
Die Handlung ist ganz passabel, und da sie sich
eigentlich nur um zwei Personen dreht, habe ich mich auf diese
beschränkt, nur eine Nebenfigur, die Köchin, hinzugefügt und den
unglücklichen Geist des Vaters über und hinter dem Ganzen schweben
lassen. Ich habe dies getan, weil ich, wie ich glaube, erkannt habe,
daß der psychologische Verlauf die Menschen unserer Zeit am meisten
interessiert und daß sie sich nicht mit der Beobachtung eines Vorgangs
zufriedengeben, ohne zu erfahren, wie sich alles ergibt! Wir wollen
gerade die Fäden sehen, die Maschinerie, wollen die Schachtel mit dem
doppelten Boden untersuchen, den Zauberring anstecken,
um die Naht zu finden, und in die Karten schauen, um zu entdecken, wie
sie gezinkt sind. Ich habe dabei die monographischen Romane der Brüder
Goncourt vor Augen gehabt, die mich von der ganzen zeitgenössischen
Literatur am meisten angesprochen haben. Was die technische Seite der
Komposition betrifft, so habe ich versuchsweise die Einteilung in Akte
aufgegeben. Ich glaube nämlich herausgefunden zu haben, daß unsere
schwindende Illusionsfähigkeit durch Pausen gestört wird, in denen der
Zuschauer Zeit zum Nachdenken hat und sich dadurch dem suggestiven
Einfluß des Verfasser-Magneti-seurs entzieht. Mein Stück dauert
vermutlich neunzig Minuten, und wenn man eine Vorlesung, eine Predigt
oder einen Vortrag auf einem Kongreß ebenso lange oder noch länger
anhören kann, so war ich der Ansicht, daß man bei einem Theaterstück
von anderthalb Stunden nicht ermüdet. Bereits 1872 erprobte ich in
einem meiner ersten Theaterversuche, in Der Friedlose, diese
konzentrierte Form, wenn auch mit geringem Erfolg. Das Stück war in
fünf Akte eingeteilt und lag fertig vor, als ich seine diffuse
gestörte Wirkung bemerkte. Es wurde verbrannt, und aus der Asche ging
ein einziger, großer, durchgearbeiteter Akt von fünzig Druckseiten
hervor, mit einer Spielzeit von einer ganzen Stunde. Die Form ist
durchaus nicht neu, scheint aber mein Eigentum zu sein und hat
möglicherweise durch einen geänderten Publikumsgeschmack Aussicht,
zeitgemäß zu werden. Meine Absicht ist es, das Publikum künftighin so
zu erziehen, daß es ein abendfüllendes Schauspiel in einem einzigen
Akt absitzen kann. Aber das erfordert zunächst Untersuchungen. Um
jedoch dem Publikum und den Schauspielern Ruhepausen zu gönnen, ohne
daß sich der Zuschauer der Illusion entzieht, habe ich drei
künstlerische Formen aufgegriffen, die alle zur dramatischen Dichtung
gehören, nämlich den Monolog, die Pantomime und das Ballett. Sie waren
ursprünglich mit der antiken Tragödie verbunden, heute entwickeln sich
jedoch aus der Monodie der Monolog und aus dem Chor das Ballett.
Der Monolog ist heute von unseren Realisten als unwahrscheinlich in Acht und Bann getan worden; wenn ich ihn aber motiviere, mache ich ihn glaubhaft und kann ihn auf diese Weise mit Vorteil benutzen. Es ist doch wahrscheinlich, daß ein Redner allein in seinem Zimmer umhergeht und seine Rede laut durchliest, ebenso wahrscheinlich, daß ein Schauspieler seine Rolle laut rekapituliert, daß eine Magd mit ihrer Katze redet, eine Mutter mit ihrem Kind scherzt, eine alte Jungfer mit ihrem Papagei plaudert oder ein Schläfer im Schlaf spricht. Und um dem Schauspieler einmal Gelegenheit zu selbständiger Arbeit zu geben und einen Augenblick vom Zeigestock des Autors frei zu sein, ist es am besten, wenn die Monologe nicht ausgeführt, sondern nur angedeutet werden. Denn da es ziemlich gleichgültig ist, was man im Schlaf spricht oder zum Papagei oder der Katze sagt, weil dies keinen Einfluß auf die Handlung hat, so ist es möglicherweise besser, wenn ein begabter Schauspieler, der sich mitten in der Stimmung und der Situation befindet, dies improvisiert, als daß es der Autor festlegt, der nicht im voraus abschätzen kann, wie viel und wie lange geplaudert werden darf, bis das Publikum aus der Illusion geweckt wird.
 Bekanntlich ist das italienische Theater an gewissen
Bühnen zur Improvisation zurückgekehrt und hat dadurch dichtende
Schauspieler geschaffen, allerdings im Sinne des Autors. Dies mag ein
Fortschritt oder eine neue, keimende Kunstart sein, bei der man von schöpferischer
Kunst sprechen kann. Wo der Monolog wieder unwahrscheinlich werden
könnte, habe ich zur Pantomime gegriffen, und da lasse ich dem
Schauspieler noch mehr Freiheit, zu dichten - und, auf sich gestellt,
Ehre zu erringen. Um aber das Publikum nicht zu überfordern, habe ich
die Musik, die schon durch den Mittsommertanz motiviert ist, ihre
illusionsschaffende Macht während des stummen Spiels entfalten lassen.
Ich bitte auch den Kapellmeister, bei der Auswahl der Musikstücke
darauf zu achten, daß keine fremden Stimmungen durch Anklänge an
aktuelle Operetten, Tanzmusik oder ethnographisch
allzu volkstümliche Melodien hervorgerufen werden.
Bekanntlich ist das italienische Theater an gewissen
Bühnen zur Improvisation zurückgekehrt und hat dadurch dichtende
Schauspieler geschaffen, allerdings im Sinne des Autors. Dies mag ein
Fortschritt oder eine neue, keimende Kunstart sein, bei der man von schöpferischer
Kunst sprechen kann. Wo der Monolog wieder unwahrscheinlich werden
könnte, habe ich zur Pantomime gegriffen, und da lasse ich dem
Schauspieler noch mehr Freiheit, zu dichten - und, auf sich gestellt,
Ehre zu erringen. Um aber das Publikum nicht zu überfordern, habe ich
die Musik, die schon durch den Mittsommertanz motiviert ist, ihre
illusionsschaffende Macht während des stummen Spiels entfalten lassen.
Ich bitte auch den Kapellmeister, bei der Auswahl der Musikstücke
darauf zu achten, daß keine fremden Stimmungen durch Anklänge an
aktuelle Operetten, Tanzmusik oder ethnographisch
allzu volkstümliche Melodien hervorgerufen werden.
Das Ballett, das ich eingefügt habe, hätte nicht durch eine sogenannte Volksszene ersetzt werden können, weil Volksszenen schlecht gespielt werden und eine Menge Griesgrame die Gelegenheit benutzen wollen, sich witzig zu zeigen und damit die Illusion zu zerstören. Da das Volk seine Bosheiten nicht improvisiert, sondern bereits fertiges Material verwendet, das eine doppelte Bedeutung erhalten kann, habe ich das Spottlied nicht selbst gedichtet, sondern ein weniger bekanntes Tanzspiel genommen, das ich in der Stockholmer Gegend persönlich aufgezeichnet habe. Die Worte treffen ungefähr, nicht ganz genau, aber das ist auch die Absicht, denn die Verschlagenheit (Schwäche) des Knechts läßt keine direkten Angriffe zu. Also keine sprechenden Witzbolde in einer ernsten Handlung, kein rohes Grinsen über eine Situation, die den Deckel auf den Sarg eines Geschlechts legt. Was nun die Dekorationen betrifft, so habe ich von der impressionistischen Malerei das Unsymmetrische, das Abgeschnittene entlehnt und glaube, in der Schaffung von Illusion einen Erfolg errungen zu haben. Denn da man nicht das ganze Zimmer mit allen Möbeln sieht, wird der Ahnung des Zuschauers Entfaltungsmöglichkeit gegeben, d. h. die Phantasie setzt sich in Bewegung und vervollständigt das Bild.
 Eine weiterer Fortschritt liegt darin, daß ich die
ermüdenden Abgänge durch Türen vermeide, zumal die Theatertüren aus
Leinwand sind, bei einer leisen Berührung schwanken und nicht einmal
dem Zorn eines erbosten Familienvaters Ausdruck verleihen können, wenn
er nach einem schlechten Abendessen hinausgeht und die Tür hinter sich
zuknallt, „daß das ganze Haus erbebt". (Auf dem Theater schwankt
es.) Ebenso habe ich mich an eine einzige Dekoration gehalten, einmal um
die Figuren mit ihrem Milieu verwachsen zu lassen, zum anderen, um mit
dem Ausstattungspomp Schluß zu machen. Wenn man nur eine Dekoration
hat, kann man allerdings verlangen, daß sie wirklichkeitsgetreu ist.
Nichts ist aber schwerer, als ein Zimmer auf die
Bühne zu stellen, das ungefähr wie ein Zimmer aussieht, wie leicht
auch der Maler feuerspeiende Berge und Wasserfälle zu schaffen vermag.
Sollen die Wände meinetwegen aus Leinwand sein, es ist aber wohl an der
Zeit, nicht mehr Gestelle und Küchengeräte darauf zu malen. Es gibt so
viele andere konventionelle Dinge auf der Bühne, die wir glauben
sollen, daß wir gern auf die Überanstrengung verzichten, gemalte
Kochtöpfe für echt zu halten.
Eine weiterer Fortschritt liegt darin, daß ich die
ermüdenden Abgänge durch Türen vermeide, zumal die Theatertüren aus
Leinwand sind, bei einer leisen Berührung schwanken und nicht einmal
dem Zorn eines erbosten Familienvaters Ausdruck verleihen können, wenn
er nach einem schlechten Abendessen hinausgeht und die Tür hinter sich
zuknallt, „daß das ganze Haus erbebt". (Auf dem Theater schwankt
es.) Ebenso habe ich mich an eine einzige Dekoration gehalten, einmal um
die Figuren mit ihrem Milieu verwachsen zu lassen, zum anderen, um mit
dem Ausstattungspomp Schluß zu machen. Wenn man nur eine Dekoration
hat, kann man allerdings verlangen, daß sie wirklichkeitsgetreu ist.
Nichts ist aber schwerer, als ein Zimmer auf die
Bühne zu stellen, das ungefähr wie ein Zimmer aussieht, wie leicht
auch der Maler feuerspeiende Berge und Wasserfälle zu schaffen vermag.
Sollen die Wände meinetwegen aus Leinwand sein, es ist aber wohl an der
Zeit, nicht mehr Gestelle und Küchengeräte darauf zu malen. Es gibt so
viele andere konventionelle Dinge auf der Bühne, die wir glauben
sollen, daß wir gern auf die Überanstrengung verzichten, gemalte
Kochtöpfe für echt zu halten.
Ich habe den Hintergrund und den Tisch schräg gestellt, um zu erreichen, daß die Schauspieler en face und im Halbprofil spielen, wenn sie sich am Tisch gegenübersitzen. In der Oper Aida habe ich einen schrägen Hintergrund gesehen, der den Blick in unbekannte Perspektiven führte und nicht so wirkte, als wäre er nur aus Protest gegen die ermüdende gerade Linie entstanden.
Eine andere, vielleicht nicht unnötige Neuheit wäre die Beseitigung der Rampe. Diese Beleuchtung von unten soll ja den Schauspielern ein volleres Gesicht verleihen; aber ich möchte fragen: Warum sollen alle Schauspieler ein volles Gesicht haben? Beseitigt nicht dieses Licht von unten eine Menge feiner Züge in den unteren Gesichtspartien, besonders um die Kiefer, verfälscht es nicht die Form der Nase, wirft es nicht Schatten über das Auge? Trifft dies nicht zu, so ist etwas anderes sicher: Die Schauspieler werden so geblendet, daß das wirkungsvolle Spiel der Blicke verlorengeht, denn das Rampenlicht fällt an den Stellen auf die Netzhaut, die sonst geschützt sind (außer bei Seeleuten, die die Sonne im Wasser sehen). Darum sieht man selten ein anderes Augenspiel als primitives Starren zur Seite oder zu den Rängen hinauf, wobei man das Weiße im Auge sieht. Möglicherweise ist auch das ermüdende Blinzeln mit den Augenlidern besonders bei Schauspielerinnen derselben Ursache zuzuschreiben. Und wenn jemand auf der Bühne mit den Augen sprechen will, gibt es nur den schlechten Ausweg, direkt ins Publikum zu blicken, mit dem er oder sie vor dem Draperierahmen in unmittelbaren Kontakt tritt - eine Unsitte, die zu Recht oder Unrecht „Bekannte grüßen" heißt.
 Könnte nicht genügend starkes Seitenlicht (mit
Reflektoren o. ä.) dem Schauspieler diese neue Möglichkeit schenken:
die Mimik durch das bedeutendste Ausdrucksmittel des Gesichts, durch das
Spiel der Augen, zu unterstützen? Ich mache mir kaum Illusionen, den
Schauspieler dazu zu bringen, für das Publikum zu spielen und
nicht mit ihm, obwohl das mein Wunsch wäre. Es ist nicht mein
Traum, eine ganze wichtige Szene hindurch den Rücken des Schauspielers
zu sehen, aber ich habe den lebhaften Wunsch, daß sich entscheidende
Szenen nicht vor dem Souffleurkasten wie beifallheischende Duette
abspielen, sondern ich möchte sie am angegebenen Platz in der
betreffenden Situation haben. Also keine Revolutionen, sondern nur
kleine Modifikationen, denn die Bühne zu einem Zimmer zu machen, wo die
vierte Wand fehlt und ein Teil der Möbel folglich dem Zuschauerraum die
Rückseite zuwendet, wird wohl bis auf weiteres störend wirken.
Könnte nicht genügend starkes Seitenlicht (mit
Reflektoren o. ä.) dem Schauspieler diese neue Möglichkeit schenken:
die Mimik durch das bedeutendste Ausdrucksmittel des Gesichts, durch das
Spiel der Augen, zu unterstützen? Ich mache mir kaum Illusionen, den
Schauspieler dazu zu bringen, für das Publikum zu spielen und
nicht mit ihm, obwohl das mein Wunsch wäre. Es ist nicht mein
Traum, eine ganze wichtige Szene hindurch den Rücken des Schauspielers
zu sehen, aber ich habe den lebhaften Wunsch, daß sich entscheidende
Szenen nicht vor dem Souffleurkasten wie beifallheischende Duette
abspielen, sondern ich möchte sie am angegebenen Platz in der
betreffenden Situation haben. Also keine Revolutionen, sondern nur
kleine Modifikationen, denn die Bühne zu einem Zimmer zu machen, wo die
vierte Wand fehlt und ein Teil der Möbel folglich dem Zuschauerraum die
Rückseite zuwendet, wird wohl bis auf weiteres störend wirken.
Wenn ich noch vom Schminken sprechen will, wage ich nicht zu hoffen, daß die Damen auf mich hören werden, die lieber schön als glaubhaft erscheinen möchten. Aber der Schauspieler sollte doch bedenken, ob es für ihn vorteilhaft ist, dem Gesicht beim Schminken einen starren Ausdruck zu geben, der wie eine Maske haften bleibt. Denken wir uns einen Herren, der sich mit Ruß einen scharfen, cholerischen Zug zwischen die Augen setzt, und nehmen wir dann an, daß er, der auf diese Weise ständig ergrimmt aussieht, bei einer Antwort lächeln muß. Wird das nicht eine entsetzliche Grimasse werden? Und wie soll diese verfälschte Stirn, die blank ist wie eine Billardkugel, in Falten gelegt werden können, wenn der Alte in Zorn gerät? In einem modernen psychologischen Drama, wo sich die feinsten Regungen der Seele mehr im Gesicht spiegeln als durch Gesten und Radau ausdrücken sollen, dürfte es wohl das beste sein, einen Versuch mit starkem Seitenlicht auf einer kleinen Bühne und mit Schauspielern ohne Schminke oder mit möglichst wenig Schminke zu machen. Könnte uns dann noch der Anblick des Orchesters mit seiner störenden Beleuchtung und seinen dem Publikum zugewandten Gesichtern erspart bleiben, könnten wir das Parkett soweit erhöhen, daß die Augen des Zuschauers höher als die Kniekehle des Schauspielers sind, könnten wir die Proszeniumslogen (die Ochsenaugen) mit ihren grinsenden und dinierenden Theaterbesuchern abschaffen und während der Vorstellung den Zuschauerraum völlig verdunkeln und vor allen Dingen eine kleine Bühne und einen kleinen Zuschauerraum einrichten, dann würde vielleicht eine neue Dramatik entstehen und das Theater wenigstens wieder Stätte der Unterhaltung für Gebildete werden. In Erwartung dieses Theaters müssen wir wohl auf Vorrat schreiben und das Repertoire der Zukunft vorbereiten. Ich habe einen Versuch gemacht! Ist er mißglückt, so ist Zeit genug, den Versuch aufs neue zu unternehmen!
[in der Übersetztung von Ruprecht Volz]